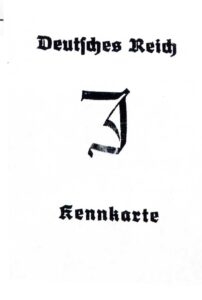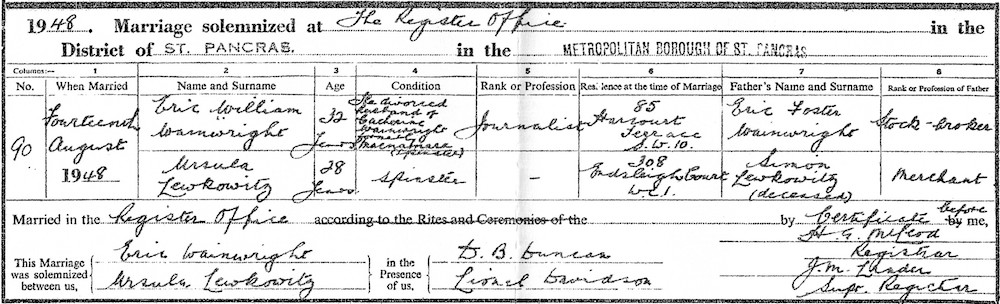Nachdem Sara und Richard am 14.4.1942 deportiert worden waren, schritt die Auswertung ihres Eigentums in raschem Tempo voran. Dies schlug sich deswegen so minutiös in den Akten wieder, weil die Behörde, der die finanzielle Vereinnahmung des beschlagnahmten Vermögens oblag, sämtliche anfallenden Kosten aus diesem, den soeben deportierten Juden geraubten, Vermögen bestritt und darüber genauestens Buch führte. So musste die Wohnung zuerst beräumt werden, bevor sie wieder vermietet werden konnte, wofür Frau “Margarete Wende, Hauswart” umgehend 10,- Mark für “Reinigung der Judenwohnung” bekam. Die Oberfinanzbehörde schrieb Postschecks und Überweisungen, während sie parallel die Konten Richard und Sara Kellermanns auflöste und deren Hausrat versteigern ließ.
Die Historikerin Susanne Willems hat präzise rekonstruiert, welche Bedeutung nicht nur die Beschlagnahme und Veräußerung jüdischen Eigentums, sondern auch die Requirierung der von Juden bewohnten Wohnungen für das NS-System hatte („Der entsiedelte Jude“, Berlin 2008). Seit 1938 war der Architekt Albert Speer “Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt” Berlin, eine Funktion mit ungewöhnlich weitgehenden Befugnissen, die nicht der üblichen Planungshoheit der städtischen Behörden unterworfen war. Speers Aufgabe war es, Berlin zur monumentalen “Welthauptstadt Germania” umzubauen. Dafür brauchte er freie Hand und freie Flächen.
Um für den brachialen Umbau Platz zu schaffen, plante seine gleichnamige Behörde, innerhalb der NS-Funktionshierarchie so mächtig wie ein Ministerium, großflächig Altbauten abzureißen, obwohl in Berlin Wohnungsnot herrschte. Abhilfe versprach man sich durch die “Entmietung” von Wohnungen, in denen Juden lebten. Systematisch wurden von Speer gutbürgerliche Berliner Wohnlagen nach jüdischen Mietern durchkämmt und diese, in drei Wellen, aus ihren Wohungen “entfernt”. Die “entmieteten” und entrechteten Juden mussten zunächst bei anderen Juden Quartier finden, ab August 1941 wurden sie gleich nach der Exmittierung aus ihrer Wohnung deportiert.
Die Bedeutung Speers im Prozess der Deportation der Berliner Juden liegt darin, dass tatsächlich er und seine Behörde den Takt und den Marschbefehl für die anrollenden Deportationen angaben. Die Gestapo, so könnte man sagen, deportierte auf Speers Bestellung. Der freiwerdende Wohnraum, oft in gefragten Gegenden, diente nicht nur der Umquartierung von Mietern, deren Häuser Speers Bebauungsplänen zum Opfer fallen sollten, sondern wurde auch zur wertvollen Verfügungsmasse, mit der man Personen innerhalb der eigenen Netzwerke belohnen und Vergünstigungen verschaffen konnte.
Bald standen verdiente Parteigenossen und Wirtschaftsfunktionäre Schlange für die begehrten großbürgerlichen Wohnungen und Häuser. Auch Richard und Sara Kellermann, die auf dem noblen Kudamm immerhin eine Wohnung mit Bad, WC, Warmwasser-Heizung, Parkett und Balkon bewohnten, fielen in dieses Raster. In ihre Wohnung zog eine alleinstehende Frau ein, ein “Fräulein Sahl”, wie es in den Akten heißt, die vorher nahe dem Tiergarten im Kernplanungsgebiet von Speers Groß-Berlin gewohnt hatte, wie man dem Berliner Adreßbuch entnehmen kann. Vielleicht war sie aber auch, im Adreßbuch als Sekretärin aufgeführt, bei einer der zentralen NS-Behörden beschäftigt, deren Büros rund um ihre bisherige Wohnung am Tiergarten lagen, und hatte so eine günstige Ausgangsposition, um eine Wohnung in bester Lage zu ergattern.
Fräulein Sahls neue Wohnung
Während das Dritte Reich sich im großen Stil am Eigentum und Vermögen der emigrierten und deportierten Juden bereicherte, profitierten ihre ehemaligen Nachbarn und andere “arische” Deutsche im Kleinen. So wie der Hausbesitzer, der die Gelegenheit beim Schopfe packte, seine Wohnung auf Kosten der deportierten Mieter sanieren zu lassen, und sich den Mietausfall erstatten ließ:
“Dr. Heinz W. Mattern / Hausverwaltungen. Berlin, den 13.7.42.
An den Oberfinanzpräsidenten, Vermögensverwertungs-Aussenstelle, z.Hd. Frau Mahnke, Berlin NW. 40, Alt Moabit 143. Betr.: Wohnung Kellermann, Kurfürstendamm.
Anbei überreiche ich Ihnen einen Kostenanschlag des Malermeister Wilhelm Plätke, Berlin-Charlottenburg, für die Wohnung des evakuierten Mieters Kellermann in Höhe von RM.550,- mit der Bitte zu der Renovation RM.300,- zuzuzahlen, da von Seiten des ehemaligen Mieters eine übernormale Abnutzung vorliegt, und das Beziehen einer solchen Wohnung der neuen Mieterin […] nicht zuzumuten ist. Gleichzeitig übersende ich Ihnen eine Rechnung des Klempners Möde, Berlin W.15, mit der Bitte um Begleichung, da bei dem ehemaligen Mieter die in Rechnung gestellten Schlüssel nicht vorzufinden waren. […] Gleichzeitig erinnere ich nochmals an die Zahlung der Mieten von April bis einschliesslich Juni 1942 mit je RM.98,- also insgesamt RM. 294,- Die Mieten ab 1. Juli 1942 werden von der neuen Mieterin gezahlt. Heil Hitler!”
“Der Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg. Berlin, W 15, 28. September 1942.
Betr.: Judenwohnung Kellermann, Berlin, Kurfürstendamm.
Über den Zustand der Wohnung vor der Instandsetzung kann nicht geurteilt werden, da die Schönheitsreparaturen längt durchgeführt und die Wohung seit 1. Juli d. J. wieder vermietet und bewohnt ist. Die in dem Kostenvoranschlag aufgeführten Arbeiten sind gemacht. Die Preise entsprechen den vom GBI [Generalbauinspektor Speer] mit der Malerinnung bei Instandsetzung von Judenwohnungen vereinbarten Sätzen. […] Der Hausbesitzer bringt vor, dass die Wohnung so verwohnt gewesen sei durch die Unterbringung weiterer Insassen, dass ihm die hohen Kosten der Gesamtreparatur nicht zugemutet werden könnten. Er gibt als Zeugen für den schlechten Zustand der Wohnung der vom Oberkommando der Wehrmacht mit der Wohnungsvermittlung beauftragten Agenten Lüdecke und die beiden Vertreter der Kommandostelle an, welche die Wohnung seinerzeit besichtigt haben.
Der in der Akte liegende Kostenvoranschlag beinhaltet eine Komplettrenovierung, inklusive Tapezieren, Streichen, Parkett abschleifen und Neulackierung von Fenstern, Türen, Heizkörpern und Jalousien für eine Gesamtsumme von 550,- RM, fünfeinhalb Monatsmieten der Wohnung. Den Mietern eine “übernormale Abnutzung” der Wohnung zu unterstellen, war ein Leichtes, da niemand mehr da war, der dies hätte bestreiten können. Die ausplündernde Oberfinanzbehörde hatte die Maßgabe, vom beschlagnahmten jüdischen Vermögen möglichst viel für die Reichskasse zu vereinnahmen. Doch man wusste auch, dass alle Beteiligten sich ihren Teil vom Kuchen sicherten. Das hinter der Argumentation stehende antisemitische Klischee der “dreckigen” und überfüllten “Judenwohnung” glaubte man bei der Oberfinanzbehörde unbesehen, und so wurde nur noch die Höhe der zu übernehmenden Kosten verhandelt:
Das Vorbringen erscheint glaubhaft. Ausserdem werden die genannten Zeugen dem Hausbesitzer ganz sicher seine Angaben bestätigen, sodass im Streitfall die Angaben geglaubt werden müssen.
Der Vertreterin des [Hausbesitzers] habe ich entgegengehalten, dass der grössere Teil der Erneuerungsarbeiten eigentliche Schönheitsreparaturen und nur der geringere Teil Erneuerungen sind, die ausnahmsweise gemacht wurden. Sie hat sich damit einverstanden erklärt, dass sie sich mit einem Pauschbetrag von zusammen 200 RM als für sämtliche Ersatzbeträge befriedigt erklärt. Hinzu kommt allerdings die Miete für den Monat Juni 1942, weil die neue Mieterin erst ab 1. Juli 1942 gemietet hat. Der gesamte Ersatzbetrag beträgt somit 290 RM.”
Vor Renovierung und Einzug des “Fräuleins” wurde das Inventar der Wohnung von Richard und Sara durch einen Schätzer taxiert. Von dieser Inventarliste existieren in der Akte zwei Versionen, eine handschriftliche, die offenbar direkt vor Ort erstellt wurde, und eine getippte Version, die als Grundlage von Verkauf und Versteigerung diente. Wer sich die Mühe macht, die schnell hingekritzelte erste Inventarliste zu entziffern und mit der später auf Schreibmaschine verfertigten zweiten zu vergleichen, stellte Abweichungen fest. So listete das handschriftliche Schätzungsprotokoll vom 4. Juni 1942 gleich zu Beginn eine Reihe offenbar hochwertiger Eichenmöbel auf:
“1 Büffet – Eiche 3 Mtr. br. flache Form; 1 Anrichte – Eiche, 1,50br.; 1 runder Tisch – Eiche; 8 Polsterstühle und 2 Polstersessel; gesamt: 1400,- [Randvermerk:] Schnitzerei”
“1 Bücherschrank – Eiche 220 br 2 hoch; 1 Schreibtisch m Sessel; 1 runder Tisch und 1 Rauchtisch; 2 Lederstühle, 1 Leder-Sessel, 1 Ohrensessel; gesamt: 1200,-”
Auch wenn es sich um eine großzügige 1-Zimmer-Wohnung gehandelt haben muss, so musste diese Menge an Mobiliar darin reichlich gedrängt gewesen sein. Die Vermutung lag nahe, dass Sara sich nach dem Tod ihres ersten Mannes in keiner rosigen Lage befand. Nur die Eichenmöbel zeugten noch von besseren Tagen.
Im Schreibmaschinenprotokoll “Inventar und Bewertung” vom 10. Juni 1942 waren diese Möbelgruppen mit “Schnitzereien”, die am 4. Juni noch auf je 1400,- und 1200,- Mark geschätzt wurden, verblüffenderweise verschwunden. Es begann stattdessen mit:
“1 Couch / Ruhebett Stoff 150,-; 1 Messingbett m. Aufl. 30,-; 1 Gaderobenschrank weiß, 60,-; 1 Grammophonschrank m. 8 Platten; 1 Staubsauger ‘Protos’, 30,-; 1 kl. Weinschrank, 10,-; 1 Tischuhr und 9 einfache Bilder, 40,-; 3 alte Koffer, 10,-; 1 Klavier schwarz, 1 Klaviersessel, 300,-; 5 Paar Herrenschuhe, 3 Paar Damenschuhe 135,-; 5 Anzüge m. Frack u. Smoking, 100,-; 7 Damenkleider, 4 Mäntel, Hüte und 3 Blusen 50,-; 1 Singer Rundschiffnähmaschine 60,-”
Und so weiter, seitenlang. Schätzwert des gesamten Inventars: RM 1.145,90. Die Eichenmöbel, zuvor allein mit 2.600,- RM veranschlagt, fehlten. Augenscheinlich hatte jemand mit Beziehungen diese Filetstücke reserviert. Mit Datum vom 11. Juli 1942 fand sich eine Kaufquittung über diese und weitere Möbel, ausgestellt auf Herrn “Dipl.-Ing. Theodor Janssen, Berlin-Dahlem, Königin Luise Str. 20” – nicht im Adressbuch, weder 1942 noch 1943, auch nicht im Teil nach Straßen, enthalten – über die stattliche Summe von 2.897,- RM. Fälschlicherweise wurde diese Summe später als Bankguthaben Sara Kellermanns verbucht. Ob die Sachbearbeiter den Überblick über die eingenommenen Gelder verloren hatten oder der Vorzugskauf des Herrn Janssen verschleiert werden sollte, war nicht rekonstruierbar. Offenkundig wollte man die Spuren dieser Transaktion verwischen, und so hatte wohl Sara nicht selbst auf der von ihr mit zittriger Hand vor der Deportation ausgefüllten Vermögenserklärung exakt diese Möbel mit kräftigem Strich wieder durchgekreuzt.
Auch anderes Mobiliar sicherten sich Interessierte gleich nach der Beschlagnahme, so der “Regierungsrat Dr. Venter”, der niemand anderes als Kurt Venter, der stellvertretende Leiter der Berliner Gestapo war (Susanne Willems, Der enteignete Jude, S. 421).
Der Rest des nunmehr seiner wertvollsten Stücke entledigten Mobiliars ging am 14. Juli 1942 in die Versteigerung. Solche Versteigerungen wurden regelmäßig inseriert, in diesem Fall im “Völkischen Beobacher” und im “Berliner Lokalanzeiger”. Hier konnte jeder Bürger aus dem Eigentum der Entrechteten ein Schnäppchen machen. Perfiderweise fand die Versteigerung der gestohlenen Güter auf dem Gelände eben der ausgebrannten Synagoge statt, in deren Hausmeisterwohnung der kleine Peter mit seinen Pflegeeltern wohnte. Ob sie wussten, dass hier das Eigentum der deportierten Juden unter den Hammer kam? (20/x)